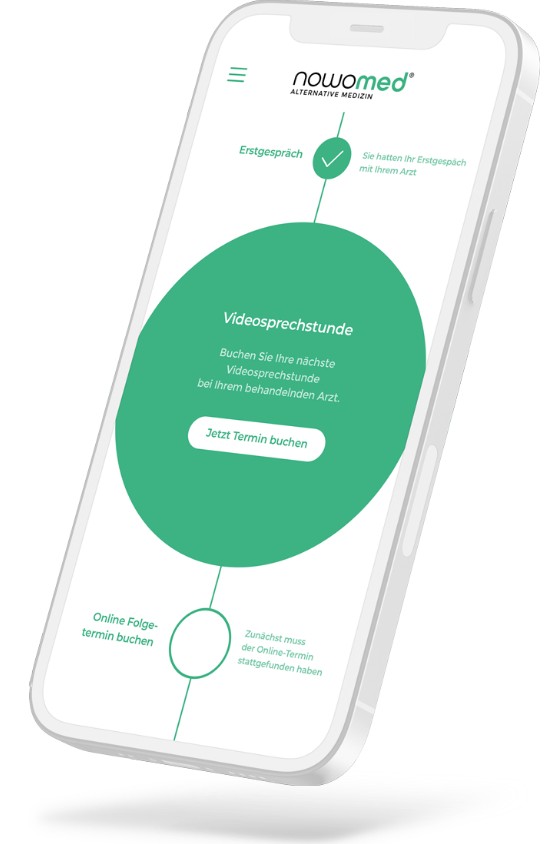Woher weiß ich, welche Sorte für mich am besten geeignet ist?
Die passende Cannabissorte lässt sich nicht pauschal bestimmen. Stattdessen wird sie individuell in Abstimmung mit einem erfahrenen Arzt oder einer Ärztin ausgewählt. Die Grundlage dafür sind Ihre Beschwerden sowie etwaige Vorerfahrungen mit THC oder CBD. Auch Begleiterkrankungen, mögliche Wechselwirkungen und Ihre Lebenssituation (z. B. Beruf, Tagesablauf, Schlafverhalten) fließen in die Entscheidung ein.
Welche Cannabissorte hat welche Wirkung?
Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Cannabissorten mit jeweils eigenem Wirkprofil. Diese werden grob in die drei Hauptgruppen Indica, Sativa und Hybride unterteilt. Indica-Sorten sind mit einer sedierenden, Sativa-Sorten mit einer stimmungsaufhellenden Wirkung assoziiert. Hybridsorten weisen Eigenschaften beider Hauptgruppen auf. Darüber hinaus hängt das Wirkprofil mit dem THC- und CBD-Gehalt und teilweise auch mit den jeweils enthaltenen Terpenen und Flavonoiden zusammen.2
Soll ich Indica oder Sativa wählen?
Die Auswahl der Medikation erfolgt in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin. Die Kategorien Indica und Sativa sind hierbei nur bedingt aussagekräftig.2 Tendenziell sind Indica-Sorten sinnvoller, wenn Sie an Schlafproblemen leiden. Sativa-Sorten tendieren hingegen zu einer weniger sedierenden Wirkung. Dadurch sind sie besser für die Linderung von Symptomen im Tagesgeschehen geeignet. Oft fällt die ärztliche Wahl auf Hybridsorten mit spezifischem Wirkprofil.
Referenzen
- Lizermann, LL. (2012). Der Cannabis-Anbau: Alles über Botanik, Anbau, Vermehrung, Weiterverarbeitung und medizinische Anwendung sowie THC-Messverfahren. Solothurn: Nachtschatten Verlag.
- Elzinga, S., Raber, J., Fischerdick, J. T. (2015). Cannabinoids and Terpenes as Chemotaxonomic Markers in Cannabis. Natural Products Chemistry & Research, 3(4).
https://doi.org/10.4172/2329-6836.1000181
- Rock, E. M. & Parker, L. A. (2021). Constituents of Cannabis Sativa. Advances in experimental medicine and biology, 1264, 1–13.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57369-0_1
- Ferber SG et al. (2020). The Entourage Effect. Terpenes Coupled with Cannabinoids for the Treatment of Mood Disorders and Anxiety Disorders. Current Neuropharmacology, 18(2), 87-96.
https://doi.org/10.2174/1570159X17666190903103923
- Baron, E. et al. (2018). Patterns of medicinal cannabis use, strain analysis, and substitution effect among patients with migraine, headache, arthritis, and chronic pain in a medicinal cannabis cohort. The Journal of Headache and Pain, 19, 37.
https://doi.org/10.1186/s10194-018-0862-2
- Campos, D. et al. (2022). A Systematic Review of Medical Cannabinoids Dosing in Humans. Clinical Therapeutics, 33(12), e39–e58.
https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2022.10.003
- Jockers-Scherübl, M. (2007). Untersuchungen zur Pathogenese, der Behandlung und dem Verlauf schizophrener Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses von Neurotrophinen und Cannabiskonsum. Diss. Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät der Charité. Berlin: Universitätsmedizin Berlin.
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/13576/Habilschrift-Jockers-Scheruebl.pdf
- Moltke, J. & Hondocha, C. (2021). Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety and sleep problems. Journal of Cannabis Research, 3(5).
https://doi.org/10.1186/s42238-021-00061-5
- Müller-Vahl, K. & Grotenhermen, F. (2017). Medizinisches Cannabis. Die wichtigsten Änderungen. Deutsches Ärzteblatt, 114(8), 352-356.
https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=186476
- Asselin, A. et al. (2022). A description of self-medication with cannabis among adults with legal access to cannabis in Quebec, Canada. Journal of Cannabis Research, 4, 26.
https://doi.org/10.1186/s42238-022-00135-y
- Kassenärztliche Bundesvereinigung (2024). Erstverordnung von Cannabis: Kein Genehmigungsvorbehalt mehr für bestimmte Fachgruppen.
https://www.kbv.de/html/1150_72326.php